Gesunde Organellen, gesunde Zellen
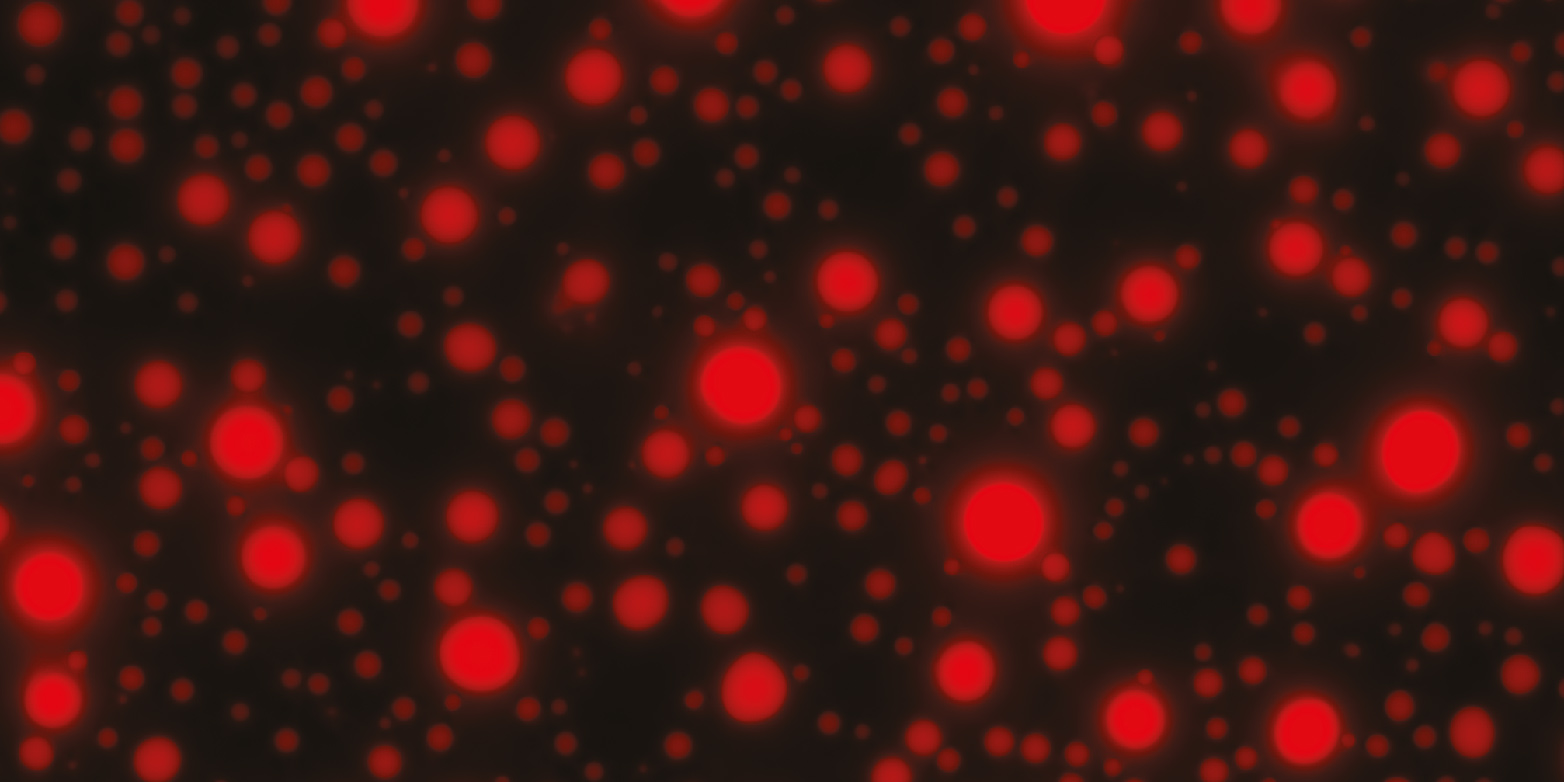
Seit Kurzem ist bekannt, wie wichtig membranlose Organellen für Zellen sind. Nun haben Biochemiker der ETH Zürich einen neuen Mechanismus entdeckt, der die Bildung solcher Organellen reguliert. Damit haben sie die Voraussetzung geschaffen, um Erkrankungen wie Alzheimer oder ALS zielgerichteter als bisher zu erforschen.
Lange Zeit hielt man den Inhalt von Zellen für ziemlich unstrukturiert und chaotisch: ein Gemisch von Proteinen, DNA und vielen kleinen Stoffwechselmolekülen. Zwar war bekannt, dass bei Pflanzen und Tieren wichtige Zellprozesse in Organellen stattfinden – das sind grössere, von einer Membran umschlossene Gebilde wie der Zellkern oder Mitochondrien. Doch erst in den letzten Jahren haben Wissenschaftler entdeckt, dass es ausserdem eine weitere Art von Strukturen gibt, die in der Organisation von zellulären Prozessen eine entscheidende Rolle spielen: sogenannte membranlose Organellen. Dabei handelt es sich um winzige Tröpfchen, die sich selbstorganisiert bilden – ähnlich wie sich Öltröpfchen in Wasser absondern.
Inzwischen deutet vieles darauf hin, dass diese Kompartimente eine grosse Bedeutung in der Medizin haben: Sie dürften an der Entstehung von rund 40 neurodegenerativen Erkrankungen beteiligt sein, darunter Alzheimer, die Huntington-Krankheit oder Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) – alle bisher unheilbar.
Karsten Weis, Biochemieprofessor an der ETH Zürich hat nun zusammen mit seinem Team erforscht, nach welchem Prinzip sich membranlose Organellen bilden und wie dieser Prozess reguliert wird.